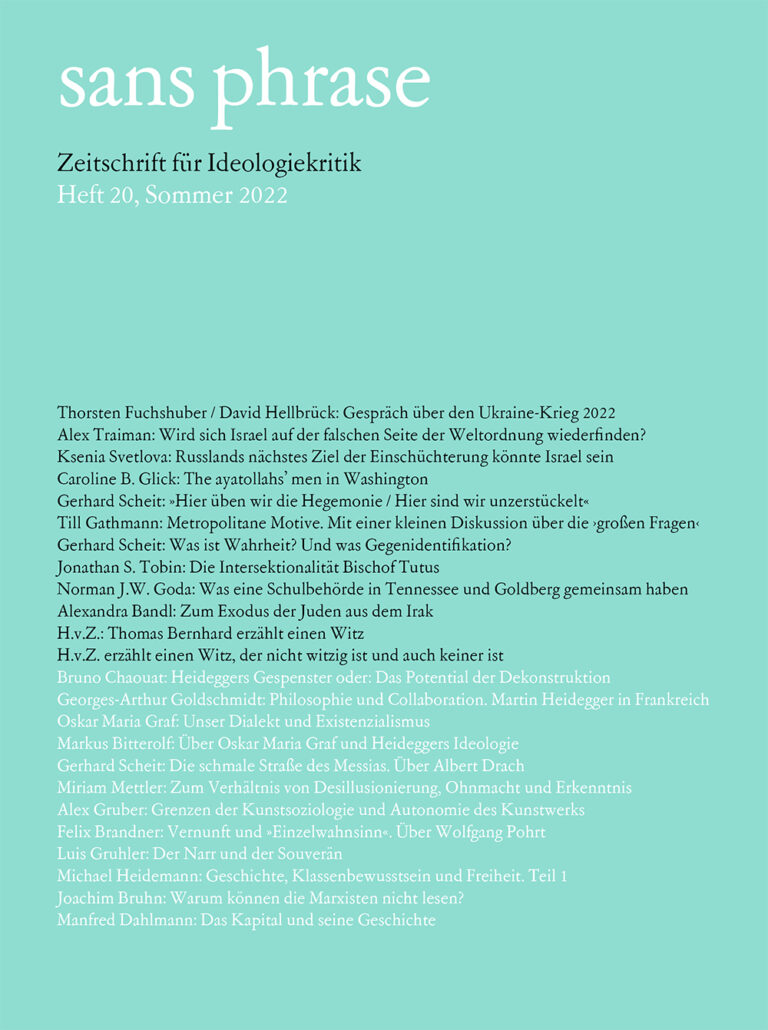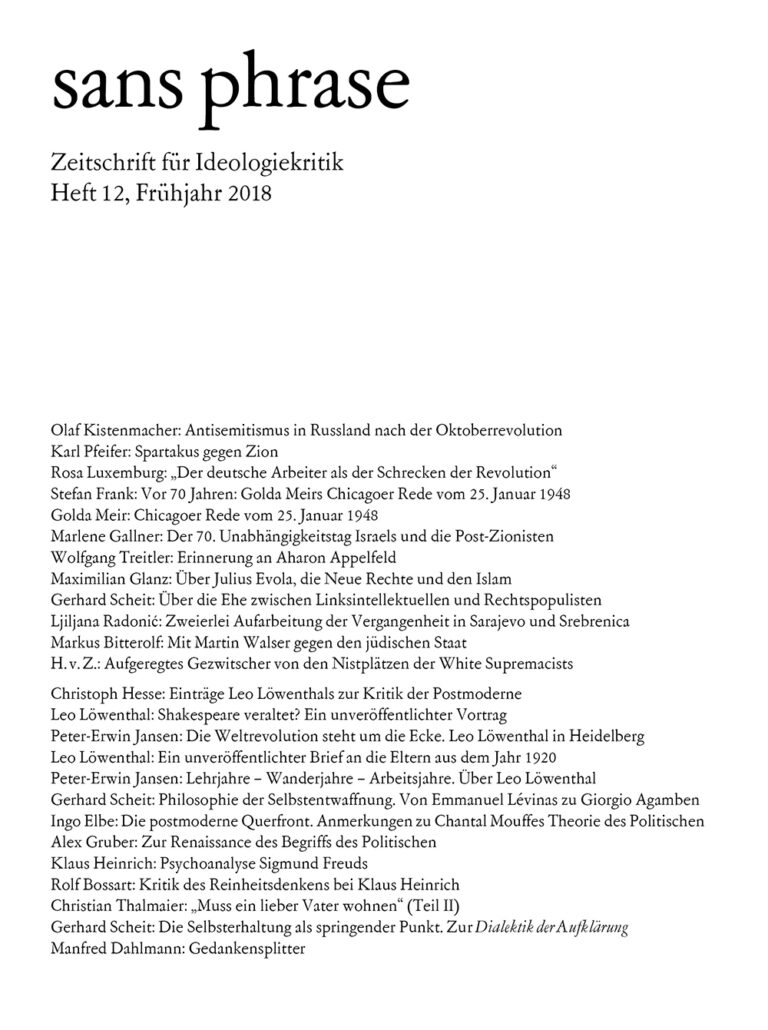Parataxis
David Hellbrück / Thomas von der Osten-Sacken
(Des-)Integrationskraft der Europäischen Union
Ein Gespräch über Asylrechtsverschärfungen, EU-Krisenverordnung und Souveränismus
Durch diese rechtliche Integration desintegrativer Bestrebungen und Entwicklungen versucht die EU, destabilisierenden nationalen Initiativen und Alleingängen vorzubeugen wie Merz, Wilders und Co. sie im Sinn haben. Dass diese Möglichkeit der Krise von innen keine explizite Berücksichtigung in der neu erlassenen EU-Verordnung findet, ist alles andere als verwunderlich, muss der EU die Krise doch als eine rein von außen kommende erscheinen, andernfalls wäre sie dazu gezwungen, auf die Frage der Souveränität und ihre eigene widersprüchliche Grundverfassung samt der Konflikte, die sich daraus für ihre Mitgliedsstaaten ergeben, zu reflektieren. Würden die Mitgliedstaaten das EU-Recht ohne Legitimation durch den EU-Rat einfach aussetzen, könnte das – allerdings nur in letzter Konsequenz – zum Entzug des Stimmrechts oder zur Einstellung der Zahlungen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU führen. Einen solchen Fall gab es bislang noch nicht und es ist sehr fragwürdig, ob der umfassende Bruch mit der EU und dem europäischen Asylrecht, das in der nationalen Gesetzgebung verankert ist, wirklich im Interesse der Einzelstaaten liegen kann. Und ich sehe derzeit bei den mit noch so spitzer Feder verfassten Forderungen nach einer Asylrechtsverschärfung kein Anzeichen dafür, dass man wirklich gewillt wäre, gelten sollendes EU-Recht, das in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung verankert zu sein hat, auf eigene Faust suspendieren zu wollen.

Eli Lake
Bibi, der Sündenbock
Wie das personifizierende Denken die politische Urteilskraft untergräbt
Es ist ein grauenvolles und unlösbares Dilemma. Die jüdische Tradition verlangt, dass ein Jude alles in seiner Macht Stehende tun muss, um eine jüdische Geisel zu befreien. Die Zahlung von Lösegeld ist in diesem Zusammenhang nicht nur zulässig, sondern unter bestimmten Umständen sogar vorgeschrieben. Und der jüdische Staat hat sich weitgehend an diese alte Praxis gehalten. Doch daraus ist ein neues Problem erwachsen. Das Gebot, die Entführten zu retten, ist für Israels Feinde zum Anreiz geworden, weitere Geiseln zu nehmen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Einsätze das Paradoxon lösen werden. Sie können auf Dauer kein Ersatz für die schwierigen Entscheidungen sein, die der Premierminister und seine Regierung treffen müssen.
Deborah Benjamin Kaufmann / Gerhard Scheit
»Ich fürchte, das kann ich in Europa nicht erklären«
Ein Briefwechsel zwischen Tel Aviv und Wien im Februar 2025
Am letzten Donnerstag habe ich nochmal den Platz der Geiseln besucht, wahrscheinlich zum letzten Mal während dieses Aufenthalts. Es war der Tag, an dem die Leichen von Kfir und Ariel Bibas zurück nach Israel gebracht wurden. Die beiden Geschwister, zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 10 Monate und vier Jahre alt, haben die Gesellschaft hier mehr noch als jedes andere Schicksal bewegt. Bis zuletzt hoffte man, sie seien am Leben. An diesem Donnerstag sind viele Menschen hier nicht zur Arbeit gegangen. Ich fürchte, das kann ich in Europa nicht erklären. Warum, wird man mich fragen, gehen Menschen nicht zur Arbeit, weil ihnen unbekannte Kinder ermordet wurden? Das ist, was ich beschreibe, wenn ich davon schreibe, dass die gemeinsame Betroffenheit und der gesellschaftliche Zusammenhalt hier ganz anders gelagert sind als in Europa. Mir ist auch klar, dass das kaum verstanden werden kann, ohne die Erfahrungen des kollektiven Gedächtnisses dieses Volkes und dieses Landes. Etwas anderes aber ist eigentlich ganz einfach zu verstehen: Was es bedeutet, bei diesen Freipressungs-Spektakeln, Bilder von der Vorführung der Särge, versehen mit dem Schriftzug »Tag der Festnahme: 7.10.2023«, bei heiterer Musik zu produzieren. Was es bedeutet, dass die Kinder, wie die forensische Analyse ergeben hat, im November 2023 mit bloßen Händen ermordet wurden. Was es bedeutet, dass ihre Angehörigen die Entscheidung treffen mussten, diese Daten freizugeben, die an mehrere unabhängige Labors im Ausland verschickt wurden, um die Obduktionsergebnisse von Dritten verifizieren zu lassen, weil sie wussten, dass die Ergebnisse eine Lüge genannt werden würden.
Gerhard Scheit
Von der antideutschen Jugendbewegung zur deutschen Sehnsucht nach Weltinnenpolitik
Über Anfang und Ende der Israelsolidarität
Ohne sich selbst durch einen praktischen Imperativ nach Auschwitz in Frage zu stellen, trägt solcher Aktivismus jedenfalls nichts dazu bei, die Situation Israels anders als moralisierend zu vergegenwärtigen und lädt insofern immer auch, sozusagen strukturell, dazu ein, sie sich – geradewegs nach Maßgabe einer ›Staatsraison‹ rationalisierend – schönzureden. Und insbesondere läuft er in der Anrufung des ›eigenen‹ Staats mit einiger Notwendigkeit Gefahr, eben die Rolle, die das internationale Recht im Antizionismus spielt, zu verkennen, indem er sich selber auf dieses Recht beruft, als wäre es Recht; als ob es einen internationalen Rechtsstaat geben könnte, und die UN wären bloß der falsche, weil israelfeindliche Weltsouverän, der unmoralisch handle und durch einen anderen, moralisch geläuterten ersetzt werden soll. Anders gesagt, die Pseudo-Utopie, die man aus Kants Ewigem Frieden gewinnen will, lautet: Es müsste nur die Außenpolitik der Gesamtheit aller Staaten, aufgefasst, als wären sie Bürgerinnen und Bürger eines Staats, das internationale Recht so auffassen und anerkennen, als ob es wirkliches Recht, als ob es von einem Souverän garantiert sei, dann wäre es auch realiter in Geltung gesetzt.
Philip Zahner
Alles gewonnen, alles verloren?
Zur Israelsolidarität im Namen der deutschen Staatsräson
Der kaum verborgene Sinn der deutschen Staatsräson scheint darin zu bestehen, den Staat der Juden als dem einzigen praktischen Einspruch gegen die Welt nach Auschwitz und die fortbestehende Möglichkeit der antisemitischen Vernichtung, unter der Hand seinen Staatszweck zu entwenden und ihn dem deutschen Souverän einzuverleiben, indem das »Nie wieder!« in höchst flexibler Bestimmung zum rechtlichen und moralischen Fundament der »wehrhaften Demokratie«, wenn nicht sogar zum inneren Auftrag und eigentlichen Zweck der Herrschaft des deutschen Staats erklärt wird, an dem sich, schon aus Gründen der schicksalhaften Verbundenheit und des paternalistischen Schutzversprechens gegenüber den Juden wegen, auch Israel messen lassen muss. So wird ideologisch ausgerechnet der »Staat des Grundgesetzes«, der die aus der Vernichtung hervorgegangene und bloß zwangsdemokratisierte Volksgemeinschaft zu seiner historischen Voraussetzung hat, als bessere und zukunftsträchtigere Alternative gegenüber dem Zionismus in Stellung gebracht, um das jetzt geläuterte Deutschland so doch noch als den legitimen Statthalter des 1000jährigen Reichs als der ewigen, weil endlich gerechten, grundgesetz-, menschen- und völkerrechtskonformen Herrschaft zu erweisen.
Albert Memmi
Was sind die Unterdrückten ohne die Unterdrücker?
Tatsächlich haben die meisten neu befreiten oder kurz vor der Befreiung stehenden Völker ein bemerkenswertes Selbstbild; bemerkenswert und doch leicht wiederzuerkennen, da es die Antithese des Bildes ist, das die Kolonisatoren von ihnen hatten. Bislang war das populäre Bild der kolonialen Eingeborenen düster, kleinlich und negativ bis hin zur Mystifizierung. Doch plötzlich sehen wir uns mit einem Wesen konfrontiert, das eine märchenhafte Vergangenheit und eine Geschichte voller Helden hat, deren würdiger Nachfahre es ist. Der Kolonisierte ersetzt von nun an die negativen Mythen des Kolonisators durch positive. Je mehr er gedemütigt und erniedrigt wurde, desto glorreicher sind die neuen Mythen.
Diese nostalgischen Gegenmythen jedoch, die sich auf die Vergangenheit stützen, sind wirksam bei der Gestaltung der Zukunft eines heranwachsenden Volks. Im besten Fall können sie bei der kollektiven Psychotherapie helfen, die jede nationale Befreiung enthält. Aber sie gefährden die kollektive Anstrengung, indem sie sie lähmen oder von dem einzigen Weg zur Rettung ablenken – dem der Wiedergeburt. Ganz zu schweigen von der unerwarteten Tatsache, dass der Gegenmythos, als Reaktion auf den Beherrscher, den Beherrschten immer noch im Sinn seiner früheren Knechtschaft definiert.
Florian Hessel
Notiz zu Albert Memmis Was sind die Unterdrückten ohne die Unterdrücker?
Über diese – wortwörtlich – postkoloniale Welt hatte Memmi stetig reflektiert. Sein Debütroman Die Salzsäule (1956, dt. 1962) und das Doppelporträt Der Kolonisator und der Kolonisierte (1957, dt. 1980) gehören der Ära des ausgehenden Kolonialismus und der antikolonialen Befreiungskämpfe an. Die in diesen Texten bereits deutlich anklingende Auseinandersetzung mit den Widersprüchen der Dekolonisierung hat Memmi in seiner Erkundung der condition juive oriental konsequent weitergedacht. Aus diesem Werkzusammenhang stammt der zuletzt in dieser Zeitschrift abgedruckte Aufsatz Bin ich ein Verräter?, der 1962 die linken, jüdischen, antikolonialistischen Intellektuellen des Maghreb und deren Verstrickung in die Katastrophe des orientalischen Judentums, dessen Vertreibung und Exilierung nach der Unabhängigkeit reflektiert. Das darin besonders plastisch hervortretende Verhältnis von Universellem und Partikularem, die Verflechtung von Gewalt, Herrschaft und Befreiung, sind dabei die zentralen Themen Memmis.
Alain Finkielkraut
Die Auferstehung des Kraken
Der Antisemitismus ändert manchmal seinen Namen, aber nie seine Haltung. Immer erzählt er uns die gleiche finstere Geschichte von Machenschaften und Verschwörung. Ob Zionist oder Jude, immer ist der negative Held dieser Geschichte mit den gleichen Kräften ausgestattet: mit denen des Kraken, dieses vielarmigen Monsters, das in seinen Tentakeln zahllose Opfer vernichtet, oder mit denen der Spinne, die geduldig ihr feines Gewebe spinnt und fast die ganze Menschheit in den Maschen ihres Netzes fängt oder fangen möchte. Porträt des Juden als Kopffüßler oder Insekt. Aber warum gerade dieses Bestiarium? Warum nimmt die Allergie gegen die Juden prinzipiell die Form einer Paranoia an? Vermutlich weil die jüdische Fremdheit keine Andersartigkeit wie die anderen ist. Denn »diese Leute« entziehen sich jeder Einordnung, der des Blicks ebenso wie der des Begriffs und der des Staats. Und wie dem Blick entzieht sich diese immaterielle Differenz auch der Definition. Sind die Juden ein Volk? Eine Religion? Eine Nation? Alle diese Kategorien sind irgendwie anwendbar, keine befriedigt wirklich. Und drittens kann man den Juden heute überall begegnen, seit der Öffnung der Ghettos entziehen sie sich als Gruppe jeder Lokalisierung. Zerstreut über die Welt, unsichtbar und unbestimmt sind sie, und genau dieses dreifache Scheitern des Strebens nach Klarheit ist es, was den Juden so leicht die Anklage der Verschwörung an den Hals zieht.
Niklaas Machunsky
Metamorphosen des Judenhasses
Zu Finkielkrauts Die Auferstehung des Kraken
Indem Finkielkraut das Selbstbild der Juden mit dem Fremdbild konfrontiert, gelingt es ihm, den Zusammenhang zwischen beiden herzustellen. Dadurch vermag er auch den Anteil der Juden an der Entstehung des antisemitischen Bildes zu rekonstruieren, ohne die Antisemiten zu exkulpieren oder die Juden für ihre Verfolgung verantwortlich zu machen. Verantwortlich ist für ihn der bürgerliche Glaube an den Fortschritt und die Hoffnung, die die Juden in ihn setzten. Nach diesem Glauben sollten sich die Juden in den modernen Nationalstaat integrieren, dabei ihre kollektive Identität weitestgehend aufgeben, um so zu Gleichen unter Gleichen zu werden. Doch die Assimilation habe unter den christlichen Bürgern Ängste befördert und dadurch gerade das Bild des Kraken entstehen lassen. Der Fortschritt, der durch die Rechtsgleichheit erreicht werden sollte, beförderte die rassistische Reaktion. Oder andersherum: Der Antisemitismus wurde rassistisch, als die Juden nicht mehr als solche zu erkennen waren, weil sie ihr Judentum aufgaben, um als Bürger in der Nation aufzugehen. Der Rassismus war eine Reaktion auf die Assimilation, die den Juden die Gleichheit versprach. Insofern ist der rassistische Antisemitismus nur eine spezifische Reaktion auf eine besondere gesellschaftliche Konstellation und kein ewiges Merkmal des Antisemitismus.
Pierre-André Taguieff
Das neue Opium der Progressiven
Radikaler Antizionismus und Islamo-Palästinismus
In den Jahren 2001 bis 2002 habe ich im Rahmen meiner Arbeiten über die »neue Judenfeindschaft« den Ausdruck »islamo-gauchisme« geprägt, um die Konvergenzen, um nicht zu sagen militanten Allianzen zwischen den linksradikalen Strömungen und islamistischen Bewegungen im Namen der palästinensischen Sache, die zum neuen großen revolutionären Zweck erhoben wurde, zu kennzeichnen. Eine der Besonderheiten des neuen Antirassismus französischer Provenienz, der von allen neulinken Bewegungen und dem Teil der etablierten Linken geteilt wird, der darauf bedacht ist, Anklang bei der muslimischen Wählerschaft zu finden (allen voran La France Insoumise), scheint seine Islamophilie zu sein, die bisweilen in Islamismusphilie abgleitet, insbesondere bei den Verehrern islamistischer Organisationen wie der Hamas oder der Hisbollah, die als ›Widerstands‹- oder ›Befreiungsbewegungen‹ gefeiert werden, und deren Hauptziel die Zerstörung des Staates Israel ist. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist der ›palästinensische Befreiungskampf‹ für Linke und Linksextreme zum ›universellen Befreiungskampf‹, um nicht zu sagen zum Kampf aller Kämpfe geworden. Vor allem durch diesen versammelte sich die antikapitalistische und antiimperialistische Linke, Waisin des Stalinismus und Maoismus, die nunmehr als totalitäre Diktaturen anerkannt sind, um eine gleichzeitig idealisierende und viktimisierende Sicht auf den Islam und die Muslime.

Geraldine Gutiérrez-Wienken / Markus Bitterolf
»Das Maduro-Narco-Regime ist Spezialist in Ablenkungsmanövern«
Beuteökonomie und Islamismus – Ein Gespräch über Venezuela nach den gefälschten Wahlen
Markus Bitterolf Immer wieder kommt es auch zu Festnahmen von Personen aus westlichen Ländern. Den Beschuldigten wird etwa Drogenschmuggel vorgeworfen. Dabei ist die linke Madurofraktion selbst Teil des internationalen Drogengeschäfts.
Geraldine Gutiérrez-Wienken Das Maduro-Narco-Regime ist Spezialist in Ablenkungsmanövern. Ich würde sogar behaupten, dass die gesamte Politik von Maduro nie links orientiert war, so wie man dies in Europa kennt. Beispielsweise fand und findet in Venezuela keine Umverteilung von oben nach unten, sondern eher von unten nach oben statt. Eine andere Elite profitiert von der »linken« Politik. Die Gehälter und Pensionen bleiben extrem niedrig und verlieren durch permanente Inflation sogar noch weiter an Kaufkraft.
Während venezolanisches Gold für obskure Geschäfte in die Türkei fließt, hat Venezuela, neben Kolumbien, eine wichtige Führungsrolle im Kokainhandel übernommen. Maduro wird in der Region als der Chef des Sonnenkartells (»Cartel de los Soles«) gesehen. Das erklärt zum Teil, warum die Regierungen von Kolumbien, Nicaragua und Honduras immer noch zu Maduro halten, im Gegensatz zu fast allen anderen lateinamerikanischen Ländern.
Das Regime hat Venezuela zu einer Operationsbasis für Narco-Terroristische-Gruppen (zum Beispiel Hisbollah) gemacht. Interessanterweise verfügt Venezuela über direkte Flugverbindungen nach Istanbul, Damaskus, Moskau und Teheran.
Essay
Jan Andres Hartmann
Einheit der Geschichte, Schrecken des 7. Oktobers
Über Kants Motiv des Geschichtszeichens als Index der Gegenaufklärung
Bereits der 11. September 2001, so Joachim Bruhn damals, sei als ein kantisches Geschichtszeichen unter umgekehrten Vorzeichen zu interpretieren, denn nicht die Linke, sondern die Barbarei habe ihr »wahrlich epochales Programm« verwirklicht. Auch für die Offenbarungswirkung des 7. Oktobers stellt sich die Frage nach der Übertragung dieses Motivs, dessen Verweis auf die Einheit der Weltgeschichte bei Kant zugleich das Vermögen der Einbildungskraft und damit die ständige Möglichkeit des falschen Zusammenkommens von Innen und Außen, also des Wahnsinns, für die Subjektivität berührt. Auf der anderen Seite jedoch scheinen diejenigen, die im Kontext des 7. Oktobers mit dem Zeichen hantieren, die wichtigste Voraussetzung Kants, dass eben selbst das Geschichtszeichen noch an das »freihandelnde Wesen«, also an reflektierende Subjektivität geknüpft ist, zugunsten eines sich selbst offenbarenden Zeichens ganz im Sinn des heideggerschen Ereigniskults kassiert zu haben. Es muss so gesehen zweierlei Verhältnis zum Geschichtszeichen betrachtet werden, um die Möglichkeit einer Übertragung des Motivs auf den 7. Oktober zu bestimmen: Einerseits die Anlage des Wahnsinns bei Kant selbst, durch die das Subjekt, noch indiziert durch das heutige Zeichen, verstrickt ist. Andererseits die dem Geschichtszeichen bei Kant zugrundeliegende Trennung von Subjekt und Objekt, mit der dem heutigen Umschlag des Zeichens zum alles erleuchtenden Ereignis Einhalt zu gebieten wäre.
Frederick Olafson / Herbert Marcuse
»Philosophie der Kapitulation«
Gespräch mit Herbert Marcuse über Martin Heidegger
Ich leugne nicht, dass Authentizität, in einem weniger unterdrückerischen Sinn, in der fortgeschrittenen Gesellschaft von heute immer schwieriger wird, aber mir scheint, dass selbst im positiven Sinn die Authentizität vom Tod überschattet wird, von der Interpretation der Existenz als auf den Tod ausgerichtet, und von der Einverleibung des Todes in jede Stunde und jede Minute deines Lebens. Das wiederum halte ich für eine höchst repressive Vorstellung, die dazu dient, die starke Fokussierung des Faschismus und des Nationalsozialismus auf das Opfer, das Opfer an sich, als Selbstzweck zu rechtfertigen. Es gibt einen berühmten Satz von Ernst Jünger, dem Nazischreiber, der von der Notwendigkeit des Opfers spricht: »am Rande des Nichts oder am Rande des Abgrunds«. Anders gesagt, ein Opfer, das gut ist, weil es ein Opfer ist und weil es vom Individuum frei oder angeblich frei gewählt wurde. Heideggers Begriff wiederholt den Schlachtruf der faschistischen Futuristen: »¡Viva la Muerte!« [dt.: »Es lebe der Tod!«].
Jan Rickermann
Der letzte Dreh an der transzendentalen Schraube
Herbert Marcuses Rückblick auf Heideggers negative Aufhebung der Philosophie
Da Marcuse Heideggers Destruktion der Geschichte der Ontologie als Rückbindung der Ideen an das gesellschaftliche Sein materialistisch umdeuten wollte, bemerkte er nicht, dass es Heidegger keineswegs versäumte, die Frage nach dem Inhalt zu stellen, sondern seiner Philosophie vielmehr eine Form gab, die auf »die grundsätzliche Abweisung der Was-Frage als solcher« zielte. Wenn Heidegger folglich das große Erbe der Philosophie antritt, dann nur »um ihren Kern in sein Gegenteil umzukehren«. Als »Selbstaufhebung der Transzendentalphilosophie« soll die Metaphysik zugunsten einer Seinsgeschichte aufgelöst werden. Heideggers existenziale Begriffe sind »mit Absicht zwischen den transzendentalen und den empirischen angesiedelt« und daher »keine Begriffe, sondern Affekte«, die sich jeder Beurteilung entziehen. Gegenüber Marcuses materialistischer Umdeutung konnte Heidegger in Sein und Zeit auf eine Stimmung setzen, in der der Bürger seinen »Untergang in der Endkrise« vorausträumte.
Aaron Steinberg
Georg Lukács, der erste marxistische Theologe
Über Geschichte und Klassenbewusstsein (1924)
Hätte es Lenin nicht gegeben, hätte der Marxismus, wie Lukács ihn versteht, sich ihn erfinden müssen: Der Lehrer, der »im Namen der Macht spricht«, ist eine zwangsläufige Folge der Lehre selbst. Die Persönlichkeit Lenins ist von nun an so untrennbar mit dem Schicksal des Marxismus verbunden wie der Mohammedanismus mit Mohammed. Künftige Überlegungen über das Wesen des Marxismus müssen zwangsläufig versuchen, die Lehren von Marx und die Person Lenins als ein einziges Phänomen zu begreifen. Eine absolute Wahrheit muss für Lukács eine konkrete Wahrheit sein. Das Proletariat als absolutes Subjekt-Objekt muss in der Wirklichkeit in einer lebenden Person verkörpert sein. Andernfalls bliebe es für Lukács leere Abstraktion, das heißt: Es wäre nicht das, was es für jenen Mann ist, der es vergöttert, jenen bis zuletzt glühenden Proselyten. »Es gibt kein Absolutes außer dem Proletariat und Lenin ist sein Prophet« – der zweite Teil der Formel folgt notwendig aus dem ersten.
Felix Brandner
»Unseren Lenin haben wir nicht mehr, einen zweiten Lenin gibt es in der Welt nicht«
Georg Lukács und der Bolschewismus
Am Ende seiner Besprechung Georg Lukács, der erste marxistische Theologe hält Aaron Steinberg den Konflikt fest, mit dem Lukács im Anschluss an Geschichte und Klassenbewusstsein konfrontiert war: was tun, wenn sich die Beschwörung jenes allgemeinen und durch die Partei angeblich immer schon verkörperten Willens des Proletariats gegen ihren eigenen Theoretiker wendet? Im Ganzen bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder kündigt Lukács die selbstverordnete Logik absoluter Parteilichkeit gegenüber der Partei zugunsten des kritischen Impulses auf oder er wird zwischen Parteistandpunkt und Revision zermalmt. Wie Lukács sich entscheiden sollte, konnte Steinberg zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Überlegungen im Sommer 1924 noch nicht wissen. Nachhaltig beeindruckend an Steinbergs Besprechung ist darum, wie früh er die Bedeutung von Geschichte und Klassenbewusstsein für eine philosophische Grundlegung der Politik Lenins wahrzunehmen vermochte und wie gut es ihm dabei zugleich gelang, die Kritik zu antizipieren, die auch Lukács selbst als Konsequenz seiner eigenen Gedanken entgegenschlagen sollte, nachdem der Leninismus sich als einheitliche Weltanschauung des Bolschewismus konsolidiert hatte. Die Rede der Neuen Linken von der vielbeschworenen Gegentradition des ›westlichen Marxismus‹, als dessen Gründungsdokument Lukács’ Geschichte und Klassenbewusstsein gilt, macht allzu leicht vergessen, dass der Fluchtpunkt von Lukács’ Überlegungen aller philosophischen Häresie zum Trotz immer Moskau geblieben ist: seine philosophische Reformulierung des Marxismus durch die Rückbesinnung auf die Schriften von Marx und des deutschen Idealismus sind auch die theoretische Grundlegung des Leninismus.
Gerhard Scheit
Naturen
4. Teil: Bruchstücke zur Kritik der politischen Ökonomie als teleologischer Urteilskraft
Adorno spricht in der Negativen Dialektik vom »metaphysischen Vorbehalt Kants«, gegen den sich der deutsche Idealismus im Begriff des Absoluten vergangen habe. Die Kritik der politischen Ökonomie erschließt sich ihrerseits nicht zuletzt unter diesem Vorbehalt, soweit sie den Wert als das Absolute in Frage stellt.
Im Unterschied zu allen Gestalten der unmittelbaren Herrschaft besteht das Irrationale und das Rationale des Kapitalverhältnisses gerade darin, die Zeit, wie sie Kant als Form des inneren Sinns bestimmte, zur Form gesellschaftlicher Synthesis zu machen. Was in der Kritik der reinen Vernunft über das Verhältnis der Zeit zum äußeren Sinn des Raums geschrieben steht, kann darum als einer der Anfangsgründe der Kritik der politischen Ökonomie gelesen werden. Wenn es aber möglich geworden ist, dass der innere Sinn in einen äußeren Zwang sich verkehrt hat, der im Souverän Absolutheit beansprucht, dann eignet sich in der Kritik der politischen Ökonomie sogar auf ganz besondere Weise auch die Kategorie der Substanz zur verkehrten transzendentalen Idee, zur Bestimmung des Werts: Die Arbeit ist durch die Zeit, die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion der Ware, Substanz des Werts, das bedeutet: gereinigt von allen Relationen zum Akzidentiellen, zu den ›lebendigen‹ konkreten Privatarbeiten und deren jeweiligen ›Privatumständen‹ – zuallererst dem physischen und psychischen Elend.
Rolf Bossart
Transzendenz als Erfahrung
Zu Eric Voegelins Kritik moderner Denkfiguren als Dialektik der Aufklärung anderer Art
Moderne Denksysteme sind meist auf der Suche nach Transzendenz, um sie, wo sie sie finden, auszutreiben und gleichzeitig darin – quasi als Befreiungsgestus in Permanenz – die Bedeutsamkeit zu erhalten, die sie ohne Transzendenz nicht mehr haben. Voegelins Kritik zielt auf diese Entsorgung der Transzendenz als maßgebende Entität eines vernünftigen Denkens menschlicher Wirklichkeitswahrnehmung, die das Denken im metaxy, das heißt, in Spannungen und mit dem Ziel der Vermittlung schwächt. Eine negative Folge davon erkennt er in der Bildung von religiösen Derivaten und Ersatzreligionen, vor allem von politischer Religiosität in manichäischen Denkgebäuden, die zur geistigen Voraussetzung von totalitären Systemen werden Dass sein Denken der Transzendenz daher auch stets alle Symbolisierungen und Artikulationsversuche dem Verdinglichungs- und Regressionsverdacht aussetzen muss, ohne die Notwendigkeit einer stetigen Verkörperung von Transzendenzerfahrung zu leugnen und die je spezifischen Qualitäten der einzelnen Versuche zu erwägen – diese doppelte Denkaufgabe kann wohl als Voegelins religionsphilosophisches Vermächtnis im Kampf gegen Realitätsverkürzung auf allen Seiten aufgefasst werden.