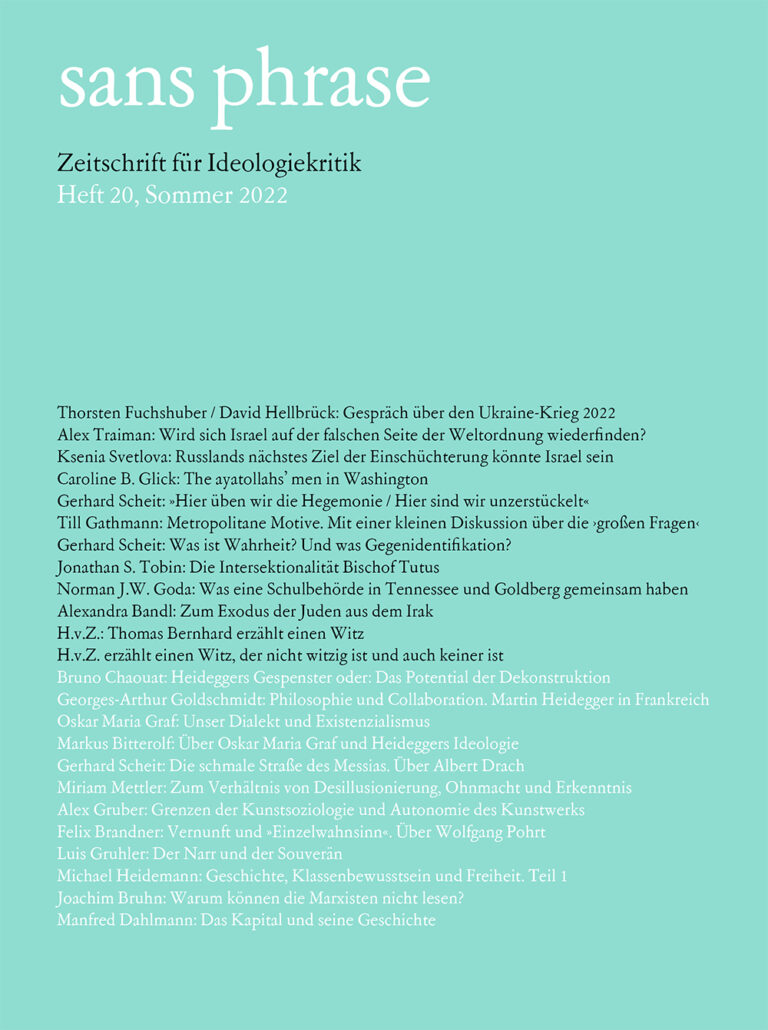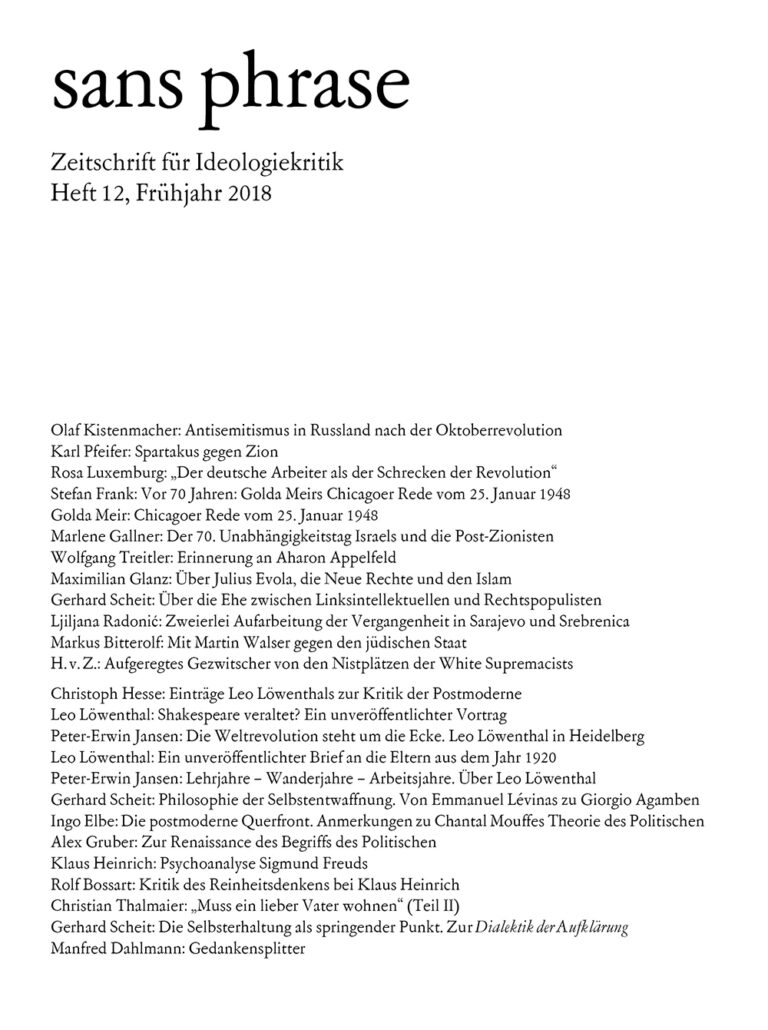Der Angriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung am 7. Oktober war keine Kriegshandlung, wie wir sie uns normalerweise vorstellen, sondern etwas sehr viel Schlimmeres. Wir haben keinen adäquaten Begriff für das, was an diesem Tag geschah, also werden Worte wie »Terrorismus«, »Barbarei«, »Gräueltat«, »Massaker« und so weiter verwendet. All diese Begriffe sind richtig, und doch werden sie dem Vernichtungswahn, der auf dem Nova-Musikfestival und in den Kibbuzim und Kleinstädten im Süden Israels losbrach, nicht gerecht. Die Hamas ist am 7. Oktober angetreten, die Existenz des jüdischen Staates so energisch wie möglich rückgängig zu machen. Ihre Bluttaten an diesem Tag zielten darauf ab, Juden zu demütigen und zu töten und andere dazu zu bringen, dem jüdischen Staat kollektiv ein Ende zu bereiten – ein Vorhaben, das an einige denkwürdige Worte des ungarisch-jüdischen Schriftstellers und Holocaustüberlebenden Imre Kertész erinnert: »Und der Antisemit unserer Zeit will nicht mehr von den Juden abrücken, er will Auschwitz.«
Heft 24, Sommer 2024
Parataxis
Alvin H. Rosenfeld
Sehnsucht nach Auschwitz
Weshalb der 7. Oktober auf die Wiederholung des Schlimmsten zielte
Redaktion Polémos
Hinter dem Ruf nach Kontext verschanzen sich die Mörder
Über islamistische Rackets und antisemitische Gewalt am 7. Oktober
Um sich mit den grauenvollen Terrorangriffen vom 7. Oktober auseinandersetzen zu können, braucht es einen Blick auf den Kontext, in dem sie stattfanden. Ausgegangen sind die Taten von einem Quasistaat in Gaza, in dem die Hamas tonangebend ist: Zwar fehlt ihr die Souveränität nach Außen – ein Staat in Gaza ist international nicht anerkannt und die Hamas bemüht sich auch nicht um diese Anerkennung. Sie verfügt über keine eigene Währung und kann damit keine eigene Finanzpolitik betreiben. Die Hamas ringt jedoch in festen Grenzen um die Herrschaft über den Küstenstreifen, sie stellt den Einwohnern des Küstenstreifens öffentliche Güter wie ein Gesundheits- und Bildungssystem zur Verfügung. Diese Quasistaatlichkeit wird in der weltweiten Debatte über ein Ende der zum Nahost-Konflikt verharmlosten antisemitischen Gewalt gerne ignoriert. Der Quasistaat im Gazastreifen basiert auf einer Rentier- und Racket-Ökonomie. Anders als andere nationale Rentierökonomien beruht diese nicht auf Ressourcen wie Öl oder Gas, die man mit verhältnismäßig geringem Aufwand fördern, exportieren und die so erzielten Gewinne unter dem geneigten Klientel verteilen könnte. Was die Hamas unter den Augen Israels in Gaza in den letzten Jahren unter die nationale Umma brachte, war die Entwicklungshilfe westlicher und die direkte Unterstützung arabischer und islamischer Staaten. Damit diese »sekundären Renten« fließen können, muss der latente Kriegszustand gegenüber Israel aufrechterhalten werden, das Elend in den palästinensischen Gebieten reproduziert und die Gewalt gegen den jüdischen Staat Israel ständig fortgeführt werden.
Danyal Casar
Die ewige Verschwörung gegen das Türkentum
Nicht erst seit dem 7. Oktober eskaliert der antijüdische Furor in der blutroten Republik
Wirkte Erdoğan in den ersten Tagen nach dem Pogrom vom 7. Oktober angesichts der Vielzahl an rivalisierenden antizionistischen Einpeitschern fast wie ein Getriebener, gelang es ihm bald darauf wieder, sich als Oberhaupt der faschistischen Agitatoren zu inszenieren. Bei der Istanbuler Massenchoreografie am 28. Oktober, zu der die türkische Staatsfront aufgerufen hatte, drohte er Israel unverhohlen damit, dass »wir eines nachts unerwartet kommen« könnten. Die Masse an Brüllvieh sekundierte: »Hier ist die Armee, hier ist der Kommandeur«. Das antizionistische Geschrei verrät vor allem die eigenen revanchistischen Gelüste der nationalen Entgrenzung. So sprach Erdoğan am 28. Oktober unverhohlen davon, dass Gaza, Skopje, Thessaloniki, Mossul und Aleppo ihnen ebenso gehöre »wie unser Blut und unsere Seele«. Und natürlich raunte Erdoğan an jenem Tag auch von den Dunkelmännern hinter den »erbärmlichen Terroristen« in Nordsyrien. Sein antiimperialistischer Opfermythos ist projizierter Geltungsdrang, in Unschuld sich verhüllende imperiale Aggression.

Gerhard Scheit
Der praktische Imperativ nach Auschwitz bei Jean Améry
Über das gebotene Scheitern des »radikalen Universalismus« (Omri Boehm)
Niemandem aber unter denen, die sich heute – gegen die aktuelle Regierung von Netanyahu gewandt (obwohl hier Folter gar kein Thema ist) – auf seinen letzten Artikel zu Israel eifernd politisierend und moralisierend berufen, kommt natürlich in den Sinn, dass er, wenn er zunächst den Primat des jüdischen Staats zugunsten abstrakter Moralphilosophie zurücknahm, etwas von seiner eigenen, immer schwieriger werdende Lage innerhalb der deutschsprachigen Öffentlichkeit preisgegeben haben könnte; mit anderen Worten: dass es sich um den Beginn eines vollständigen Rückzugs, wenn nicht eine der Ankündigungen seines baldigen Suizids handelte. So wie alle, die sich nach dem 7. Oktober auf diesen Artikel berufen wollen, um den praktischen Imperativ, den Primat des jüdischen Staats, auszulöschen, darüber geflissentlich hinweggehen, dass Améry am Ende des Textes die Zurücknahme selbst wieder zurücknahm, oder anders ausgedrückt: dass der radikale Universalismus, mit dem er anhebt, zuletzt doch an diesem Imperativ scheitern muss.
Marlene Gallner
Die Barrikade vereint mit den Intellektuellen gegen den Staat der Juden
Zum Verhältnis von geistigem Arbeiter und seinem Publikum
Der psychische Gewinn für den Antisemiten damals wie auch für den Antizionisten heute ist es, seinen inneren Konflikt zwischen der »Neigung zum Aufruhr« und dem »Respekt vor der Obrigkeit« im Judenhass zu lösen. Weil die Geisteswissenschaftler – wie übrigens auch die Künstler, die sich in einer ähnlichen Situation befinden – zurecht ahnen, wie leicht sie gesellschaftlich suspendiert werden können, da sie, um es im Vokabular der Coronapandemie auszudrücken: nicht »systemrelevant« sind, drängt es sie zur Rebellion. Allerdings nicht gegen die tatsächliche Autorität – im psychoanalytischen Sinne den Vater –, sondern in einer Verschiebung gegen einen anderen Feind, von dem sie, allein durch seine Unterzahl und mangelnden Verbündeten, keine Strafe befürchten müssen. Sie haben die Gewissheit, dass ihr Verhalten keine schwerwiegenden Nachteile für sie bedeutet. – Im Gegenteil: Je näher man sich am Nerv der Zeit bewegt, desto besser stehen die Chancen für die eigene Karriere.
Joachim Bruhn
Materialistische Aufklärung oder Manipulation von links?
Materialistische Aufklärung oder Manipulation von links? Über das Verhältnis von Theorie und Agitation heute
Wer von Vermittlung spricht, sagt Herrschaft: Nicht, wie der Marxismus, gar: der Marxismus-Leninismus sagt, geht es darum, Theorie und Praxis zu vermitteln, sondern, wie Materialismus es fordert, die Bedingung der Möglichkeit ihres Auseinandertretens theoretisch zu kritisieren und praktisch zu destruieren. Es ist dieser intellektuelle Vermittler, der, wie jeder Verkäufer die Reklame, einer Didaktik, Pädagogik und besonderen Technik bedarf, um seine Ware, das heißt die Aufklärung, das heißt das Denken in der Warenform, unter die Leute zu bringen, heiße diese Manipulationskunst nun (Bundeszentrale für) »politische Bildung« oder eben, von links, Agitation und Propaganda. Indem der Intellektuelle jedoch die Funktionen der Vermittlung und Synthesis reklamiert, okkupiert er nichts anderes für sich als das idealisierend zur Prämisse von Aufklärung schlechthin stilisierte Recht des Aufklärers selbst, dem Zwang zur materiellen Reproduktion durch die freiheitsträchtige Pflicht der geistigen Produktion zu entkommen. Er reklamiert das Privileg, aber er reklamiert es nicht im Zuge eines eigennützigen Lobbyismus, sondern als bloß arbeitsteilig mit der theoretischen Arbeit an der Einsicht in die Notwendigkeit von der Gesellschaft betrauter Kommissar.
Sebastian Tränkle
Der Widerruf des Kinderglücks
Über Albert Cohens Oh, ihr Menschenbrüder
Wenn der alternde Schriftsteller auf sein kindliches Selbst zurückblickt, so weiß er, was aus dem Menetekel an den Wänden von Marseille geworden ist: Der »alte Tötungswunsch« hat sich im Unmaß verwirklicht. Und so macht Cohen sich keine Illusionen, sein Schreiben könnte dem etwas anhaben.
Wozu dann dieses Buch? Es ist das Testament des alternden Schriftstellers: Totenklage, Anklage und Appell zugleich. Mit ihm tritt Cohen den Beweis an, dass die Ohnmacht der Sprache nicht das letzte Wort hat. Indem sein Schreiben unterschiedliche sprachliche Register zieht: erzählt, reflektiert, ironisiert, appelliert, anklagt, vor allem aber durch all das hindurch erinnert, erweist es seine »schwache messianische Kraft«. In oft biblisch anmutendem Ton besingt Cohen die Toten, ohne aber ein »kindisches Jenseits« anzurufen. Im Himmel wohnt kein guter Vater, dort kreist nur ein uns allen geduldig harrender Geier. Zu Brüdern machen uns keine hehren Werte, sondern allein der uns allen gleichermaßen drohende Tod. Doch bleibt diese Klage nicht bei solcher abstrakten Universalität stehen, die stets Gefahr läuft, die besonderen Opfer der Geschichte zu verdecken. Am Ende macht Cohen überdeutlich, dass seine Trauer den in Auschwitz Ermordeten gilt, darunter Angehörigen von ihm: den jüdischen Opfern der Vernichtung, die es »ohne den Straßenhändler und seine bösartigen Gleichgesinnten, seine unzähligen Gleichgesinnten in Deutschland und anderswo«, ohne all die »Judenhasser« nicht gegeben hätte.
Fabian Kettner
Bruder Höß – Feindbild Spießer
The Zone of Interest ist besser als seine Rezeption
Seit Martin Broszats Vorwort zu Kommandant in Auschwitz überrascht, mit wie viel Spott, Hohn und Verachtung über Höß’ angebliche Spießigkeit hergezogen wird. Richtig in Rage gerät der Deutsche, wenn er im Nazi den Spießer entdeckt (als würde er es ihm übelnehmen, nicht der ›richtige Nazi‹ zu sein). In seiner Verachtung wird er wortreich. Anders ist es bei der Judenvernichtung: über die gebe es nicht viel zu sagen, weiß man seit Broszat, der dasselbe sagt wie Höß: sauber, sachlich, ruhig, lautlos und ohne Qualen sei es da zugegangen.
In dieser Kritik am Täter verschwindet die Judenvernichtung hinter dem Spießersein. Mit der Charakterisierung der Täter als Spießer ging die Konstitution des Selbstbildes der sich in den 1960er Jahren in Westdeutschland formierenden links-liberalen kritischen Bevölkerungskreise einher. Wenn Nazis Spießer waren, dann konnte man sich selbst und anderen zeigen, kein Nazi zu sein, indem man kein Spießer war.

Niklaas Machunsky
Das alltägliche Auschwitz
The Zone of Interest und der antizionistische Revisionismus
Glazers Film nivelliert das Besondere der Shoah, und macht sie zu einem Allerweltsereignis. Die Täter werden als ganz normale Menschen dargestellt, die sich in keiner Hinsicht von uns unterscheiden. The Zone of Interest reagiert damit auf die alten Rechtfertigungsstrategien, die die Nazis zu Monstern und Hitler zum großen Verführer, mit der Fähigkeit Massen zu verzaubern, verklärten. Dieser mythisch-verklärenden Sichtweise stellt Glazer einen bewusst nüchternen Blick entgegen. Er verzichtet darauf, das Phänomen des Nationalsozialismus mit Rekurs auf dessen eigene Mythologie zu erklären. Doch diese bewusste Enthaltsamkeit führt zu einer neuen Form, die Shoah zum Verschwinden zu bringen und eröffnet die Möglichkeit, andere Verbrechen aus Geschichte und Gegenwart für sie einzusetzen. Die Verklärung von Auschwitz zu einer Metapher für Massenverbrechen und seine Austauschbarkeit folgt jedoch einer inneren Logik, die einer beliebigen Verwendung entgegensteht. Auf dem Rangierbahnhof der Metaphern können zwar die unterschiedlichsten Orte, Personen und Taten gegeneinander ausgetauscht werden. Aber schon in der Zwanghaftigkeit, mit der der Film vom Antisemitismus absieht, kündigt sich die antizionistische Logik der Umbesetzung, als der zeitgemäßen Form der Täter-Opfer-Umkehr an. Und so ist es eben kein Wunder, dass sich – beim Publikum, bei der Kritik wie beim Regisseur selbst – quasi automatisch die Analogie von Auschwitz und Gaza ergab. So wie die Höß’ sich damals neben dem Vernichtungslager häuslich einrichteten, suggeriert Jonathan Glazer in seiner Rede, so richteten sich die Israels heute neben Gaza ein und wir alle schauten unbeeindruckt zu. So beweist der Film vor allem und anders als intendiert, dass die Verhältnisse, die Auschwitz ermöglichten, fortbestehen und die Aufarbeitung der Vergangenheit nicht gelungen ist.
Essay
Thorsten Fuchshuber
Pogrom und eliminatorischer Antisemitismus
Über sexuelle Gewalt, Lust und Aggression am 7. Oktober
Es gibt eine Tradition des antijüdischen Tötungsfestes, das Pogrom ist der genuine Ausdruck einer antisemitischen Festkultur. Und immer war das Judenmorden auch von Aufwallung und Begeisterung begleitet, was sich ja schon in dem schrecklichen Wort »Pogromstimmung« ausspricht: Die temporäre Aufhebung des Gewaltverzichts stand im Zentrum des transgressiven Moments dieser antisemitischen Festkultur. Werner Bergmann hat sich an einer »Soziologie des Pogroms« versucht und kommt dabei auch auf dessen rituellen Charakter zu sprechen. Demnach sind Pogrome Formen rituellen Handelns, in denen es um die »Reinheit der Gesellschaft« gehe. Pogrome seien »Rituale der Gewalt«, »in denen die sonst geltenden Regeln und Hierarchien zeitlich begrenzt außer Kraft gesetzt oder gar auf den Kopf gestellt werden«, in denen die sonst geltende soziale Ordnung »für einen Moment verflüssigt« wird. Auch Adorno und Horkheimer schreiben in der Dialektik der Aufklärung: »Der Antisemitismus ist ein eingeschliffenes Schema, ja ein Ritual der Zivilisation, und die Pogrome sind die wahren Ritualmorde.«
Philip Zahner
Die Fühlform des islamischen Gegensouveräns
Über misogyne und antisemitische Gewalt am 7. Oktober
Moishe Postones Kritik an Klaus Theweleits Männerphantasien stimmt zwar genau und trotzdem scheint sie der unmittelbaren Evidenz vor dem Hintergrund der praktischen Verschränkung und nur analytisch zu trennenden Amalgamierung von antisemitischer und misogyner Gewalt am 7. Oktober auch zu ermangeln, so wie seine kanonisch gewordenen Thesen zum Antisemitismus, die besonders auf die industrielle Vernichtung der Juden zielten, keine Rückschlüsse darüber erlauben, weshalb die Juden an diesem Tag ausgerechnet auf diese archaische Art und Weise getötet wurden. Wenngleich es sich beim Djihadismus mehr um eine Reaktion auf die Krise des traditionellen islamischen Patriarchats durch den Einbruch des kapitalistischen Weltmarkts handelt denn um eine Fortsetzung des Patriarchats im klassischen Sinne, hätte die Kritik, die um dessen sexualpathologische Komponente weiß, den islamischen Antisemitismus unter Berücksichtigung der veränderten gesellschaftlichen Voraussetzungen gerade im Anschluss an Postone auch psychoanalytisch, das heißt vor dem Hintergrund der psychosexuellen Konstitution des Individuums und der Abwehr- und Spaltungsmechanismen zu begreifen, die gerade die patriarchale Logik des »islamischen Phallozentrismus« für dessen Krisenbewältigung bereithält. Die Autarkiephantasien, auf die dieser in letzter Konsequenz hinausläuft, bilden nämlich erst die subjektiven Voraussetzungen für eine der Vernichtung entgegenstrebende Entgrenzung und Totalisierung der Projektion zur pathischen und damit das, was der ureigensten Tendenz des Kapitals zur Vernichtung und der von ihm selbst inaugurierten Denkform in den Kategorien der Spaltung von Tauschwert und Gebrauchswert, vom Individuum im Moment seines Zusammenbruchs selbst entgegenkommt.
Till Gathmann
Netze
Zur Bildkrise des 7. Oktobers, oder: Annäherungen an eine Metapsychologie des antisemitischen Bilds
Der 7. Oktober selbst, eine Orgie der Gewalt, ein Verbrechen schwer zu beschreibenden Ausmaßes, eine Verwirklichung des Antisemitismus sondergleichen. Die Verbreitung der Bilder der Tat, ein weiteres Verbrechen, ein Aspekt dieses – die Bilder selbst Teil der Tat. Auch gingen der Gewalt die Bilder voraus, als Vorstellung, dann Plan dessen, was passieren sollte. All diese Bilder sind keine Bilder des Antisemitismus, sondern dieser selbst, als Bildverwirklichung. Wenn diese Verwicklung von Bild und Tat der Antisemitismus selbst sind, so wäre zu folgern, muss in den Bildern etwas von ihm enthalten sein, seine Wirkweise, muss das, was ihn ausmacht, in ihnen enthalten sein. Die Spannung zwischen Bild und Tat enthält die Dynamik des Produktionsverhältnisses, das der Antisemitismus ist. So gibt das Bild als produziertes Auskunft über die Tat, die Tat als Produkt dieses Auskunft über das Bild.
Gerhard Scheit
Die Rackets und der Todestrieb
Freud gesteht zu, dass der Todestrieb um so viel schwerer zu erfassen sei als die Libido; dass er gewissermaßen nur als Rückstand hinter dem Eros zu erraten wäre »und daß er sich uns entzieht, wo er nicht durch die Legierung mit dem Eros verraten wird. Im Sadismus, wo er das erotische Ziel in seinem Sinne umbiegt, dabei doch das sexuelle Streben voll befriedigt, gelingt uns die klarste Einsicht in sein Wesen und seine Beziehung zum Eros. Aber auch wo er ohne sexuelle Absicht auftritt, noch in der blindesten Zerstörungswut läßt sich nicht verkennen, daß seine Befriedigung mit einem außerordentlich hohen narzißtischen Genuß verknüpft ist, indem sie dem Ich die Erfüllung seiner alten Allmachtswünsche zeigt.« Es ist hier die massenpsychologische Identifikation, die es nahelegt, vom Todestrieb zu sprechen als ihrem »Rückstand«. Wenn die Libido in der Stellung der Massenindividuen zur Führerfigur sozusagen gebunden ist und deshalb vor jenem unmittelbar zerstörerischen und selbstzerstörerischen Verhalten bewahrt, so ist dieser Rückstand in den Beziehungen zu jenen Objekten zu erkennen, die außerhalb des Rackets projiziert werden, wobei dieses ›außerhalb‹ nicht selten im Inneren des Rackets selbst ausgemacht wird: als jemand, der hier keine »absolut bündigen Garantien der künftigen Zuverlässigkeit« bietet.
Florian Müller
»Eine Art psychoanalytischer Roman«
Versuch über Döblins Hamlet-Roman
In der Beziehung zwischen Gordon und Alice zeigt Döblin die Verschränkung von Liebe und Hass, die Freud in seinen späten Schriften, zuerst in Jenseits des Lustprinzips, im Dualismus von Eros und Todestrieb darlegte. Nicht zufällig arbeitet Freud seine Theorien über den Todestrieb und den Wiederholungszwang anhand klinischen Materials Kriegstraumatisierter des Ersten Weltkriegs aus. Er nennt sie Spekulationen, nimmt aber klinische Beobachtungen zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Sowohl im Gegensatz von Vater und Sohn als auch zwischen den Elternfiguren wird dieser Dualismus thematisch. Edward verkörpert den Lebenstrieb, den Willen und Drang zum Leben, während Gordon und Alice nicht nur den Todestrieb, sondern dessen Vereinigung mit dem Eros, die sich in ihrem Liebeshass zeigt, verkörpern. Wie Freud schreibt, treten die beiden Triebarten – Eros und Todestrieb – nicht isoliert voneinander auf, sondern legieren sich in verschiedenen Mengungsverhältnissen, wie es in der sadomasochistischen Beziehung von Alice und Gordon deutlich wird. In gewisser Weise hat Döblin Freuds Todestriebhypothese im Hamlet-Roman literarisch ausformuliert, indem er die individuellen und kollektiven Selbstzerstörungstendenzen bloßgelegt hat: »Der Tod, nein, der Mord steckt tief in der Welt.«
Johannes Meyer-Bohe
Der Freund aller Ähnlichkeit oder warum man mit einer Registriermaschine nicht tanzen kann
Picasso, der Surrealismus und eine wenig beachtete Trennungsgeschichte
Der Unterschied zwischen Picasso und den Surrealisten lässt sich an dem aus der griechischen Mythologie stammenden Minotaure illustrieren. Das Menschenleib und Stierkopf verbindende Wesen war für Picasso ein wichtiges Motiv und gleichzeitig Wappentier der ab 1933 erscheinenden Kunstzeitschrift, bei der Breton zwar den Posten des Chefredakteurs bekleidete, die durch ihre luxuriöse Aufmachung und ihren horrenden Preis aber gleichzeitig die Läuterung des Surrealismus zur Kunst anzeigt. Der Name erinnerte die Surrealisten »an grausame und zweideutige Mythen …, deren Ursprung Freud auf das Unbewusste zurückgeführt hat«; sie sahen in ihm »die Kraft, die die Grenzen des Irrationalen durchbricht, die ihre Fesseln sprengt, um die Gesetze zu verletzen und die Götter zu beleidigen … Sie identifizierten ihn mit ihren eigenen Zielen: immerwährende, universelle Gewalttätigkeit, absolute Revolte, totale Aufsässigkeit, grenzenlose Freiheit.« Picasso hatte eine ganz andere Vorstellung von den Eigenschaften des Stier-Menschen: Solche, die er von sich selbst kannte. Und obwohl sein Minotaurus »das schnaubende Ungeheuer« war, »das eine schlafende Frau umschleicht«, bedeutete dies nicht die surrealistische Verehrung für alles, was die Surrealisten am Minotaurus »an Unnatürlichem, an Übermenschlichem, Überwirklichem entdecken konnten«, sondern es ging Picasso um dessen »›menschliche, allzu menschliche‹ Haltung«.
Stanisław Lem
Provokation
Besprechung eines ungelesenen Buches. Teil II
In einem totalitären Staat, in dem alles Menschliche verstaatlicht wurde, hatte nur die Führungsspitze das Recht, Opfer auszuwählen. In einem Staat mit großen persönlichen Freiheiten waren die selbsternannten Liquidatoren des Bösen frei darin, das Böse zu identifizieren und zu verfolgen. Diese Korrelation erklärt die Verwandtschaft beider Formationen – sie liegt in der Absolution, die sich die Mörder erteilen, denn der totale Gehorsam gegenüber Autoritäten schließt ebenso wie die totale Negation jeglichen Gehorsams das Gewissen aus, wenn es um die Prüfung der eigenen Taten geht. So gelangen beide auf verschiedenen Wegen zum identischen, blutigen Finale.
Exekutiv, aber nicht revolutionär orientiert, übernimmt der Terrorismus von der Linken nur das, was seinen Taten als ideologisches Feigenblatt dienen kann; ausgestrichen oder ausgelassen wird dagegen alles, was den Mord, sein Lebenselement, erschweren oder vereiteln könnte. Die Zukunft, der er Menschenopfer bringt, ist für ihn ebenso ein Transparent, das all seine Taten legalisiert, wie es die Vision des »Tausendjährigen Reichs« für den Nationalsozialismus war.
Gerhard Scheit
Naturen
3. Teil: Absoluter Geist und theologischer Vorbehalt
Wenn Fichtes Wissenschaftslehre aus dem Kantischen ›Ich denke‹, das alle meine Vorstellungen muss begleiten können, ein ›Ich existiere‹ macht, das als absolutes Subjekt sich selbst setzt und alles andere Existierende, damit auch die Natur, als das Nicht-Ich erst hervorbringt, so liegt darin letztlich eine mit den Begriffen der Kritik der reinen Vernunft formalisierte und verallgemeinerte Darstellung der Paranoia vor, einschließlich der Bedingungen der Möglichkeit pathischer Projektion. Das Wesen des absoluten Ichs ist damit die unendliche, unbeschränkte oder reine Tätigkeit. Alle endliche Tätigkeit ist nur als das Mittel der reinen Tätigkeit als Endzweck untergeordnet. Es kann seiner selbst als diese Kausalität nur bewusst sein, wenn es sich sein eigenes Nicht-Ich als Wider- und Gegenstand erschafft. Das ›Ding an sich‹ ist damit aber abgeschafft, und das absolute Ich nimmt alle nur denkbaren Züge einer Psychose an, die auf die narzisstische Kränkung durch jenes ›Ding an sich‹ zu reagieren nicht müde wird. Es gibt keine Dinge an sich, sondern nur für uns, damit wir an ihnen umzubildendes Material haben, sie sind nur, was wir aus ihnen gemacht haben bzw. machen sollen. Das absolute Ich vermag nur von dem Ding affiziert werden, das es sich selbst geschaffen hat, um eben davon affiziert zu werden und um es letztlich wieder zu überwinden, in sich zurückzunehmen: Politisch gesprochen, ist das absolute Ich der Staat, der den Staat im Staat bzw. den Weltmarkt überwindet, und zum geschlossenen Handelsstaat wird; ökonomisch gesprochen ist es die Arbeit, die den Gegenstand bzw. die Natur überwindet, sodass der Reichtum – wie im späteren Gothaer Programm der Sozialdemokratie – aus der Arbeit allein entsteht: Staat ohne Kapital, Arbeit ohne Natur. Das ›Ding an sich‹, das bei Kant das Gemüt affiziert und die Ursache, aber nicht der Inhalt der sinnlichen Erfahrungen ist, ohne die das ›Ich denke‹ eine völlig leere Vorstellung bleiben muss, findet sich bei Fichte durchgestrichen und durch ein Nicht-Ich im Inneren des absoluten Ichs ersetzt – als bloßer Anstoß einer Produktion, die Natur und damit die teleologische Urteilskraft wie deren Kritik überflüssig macht.