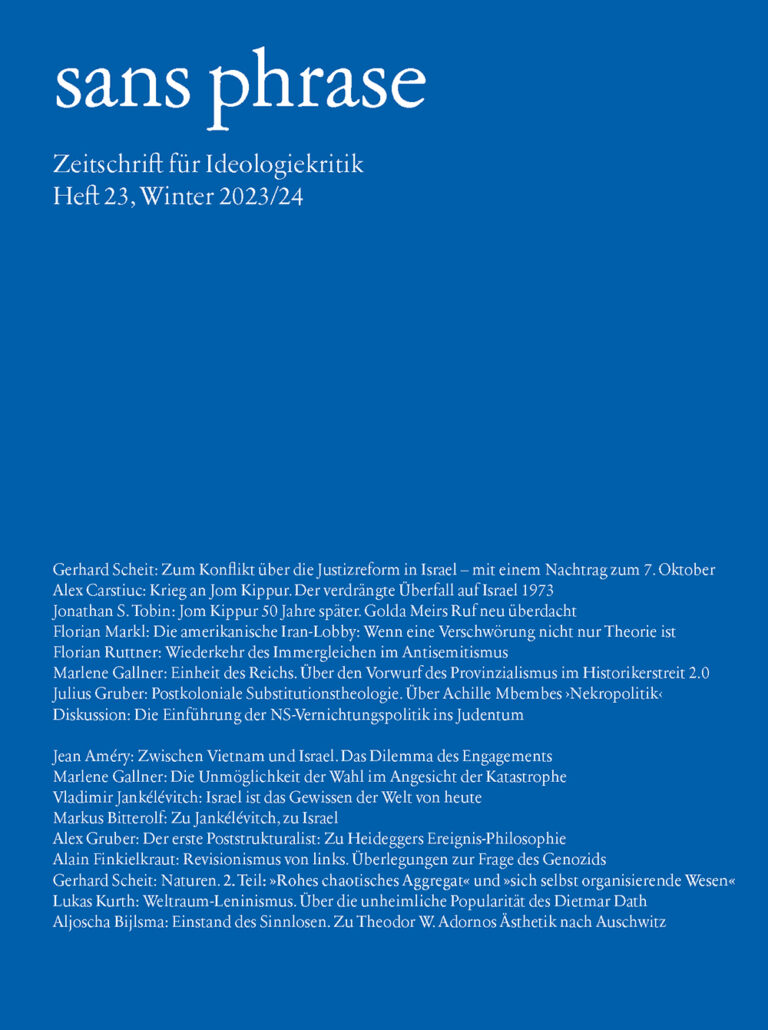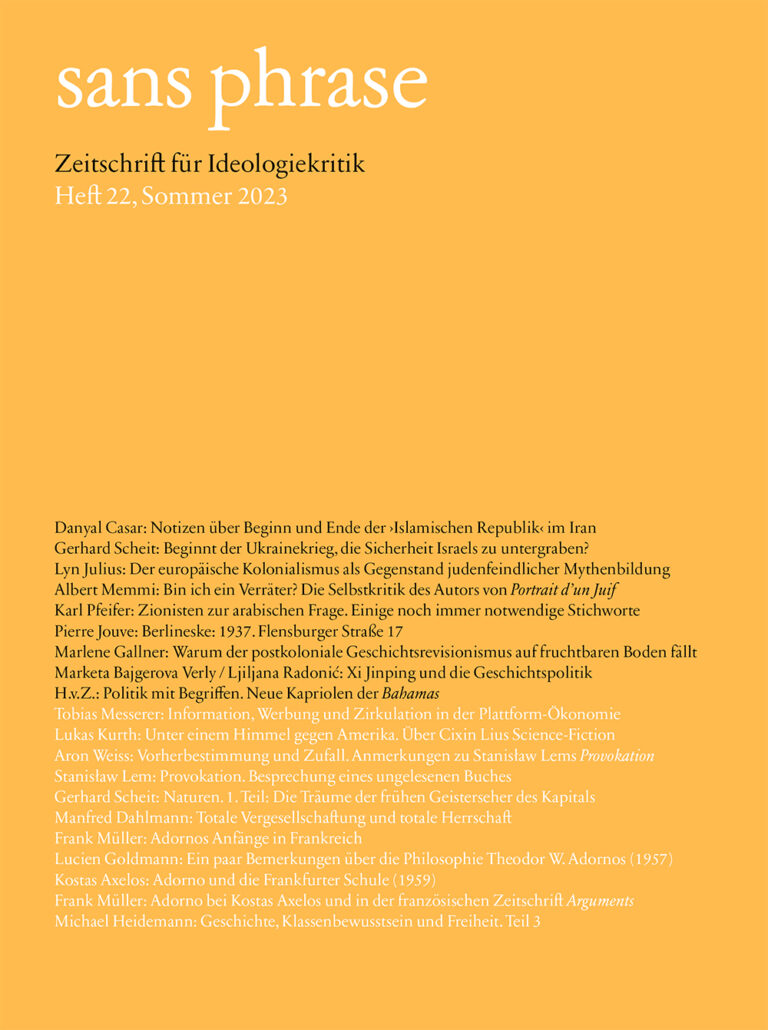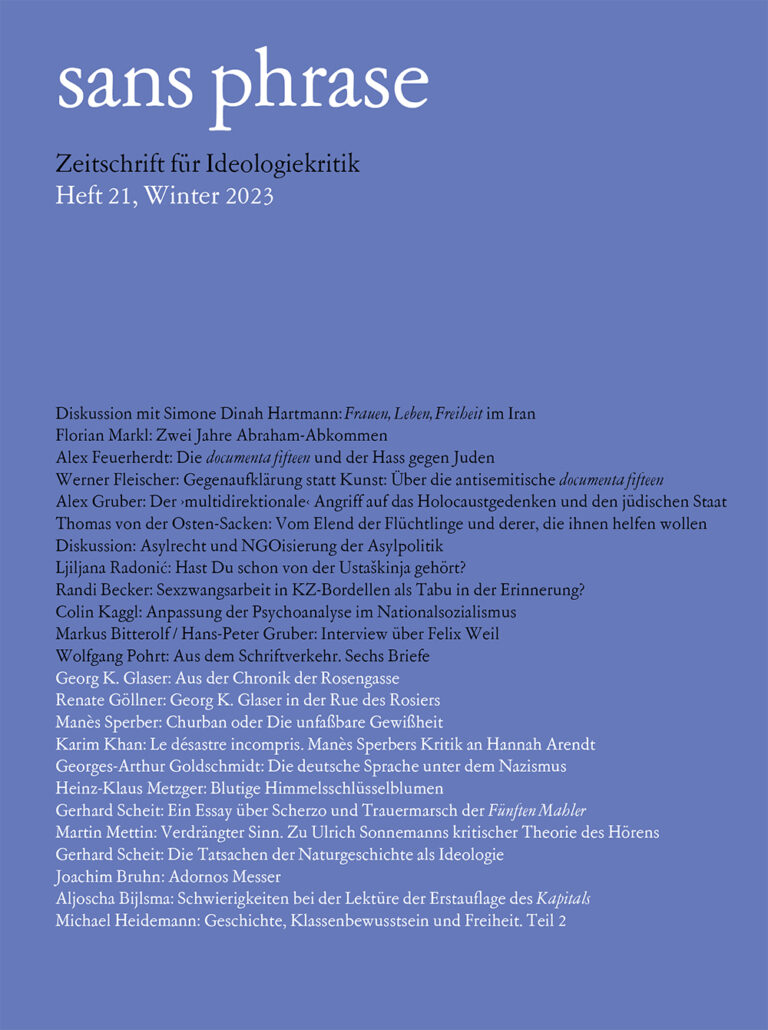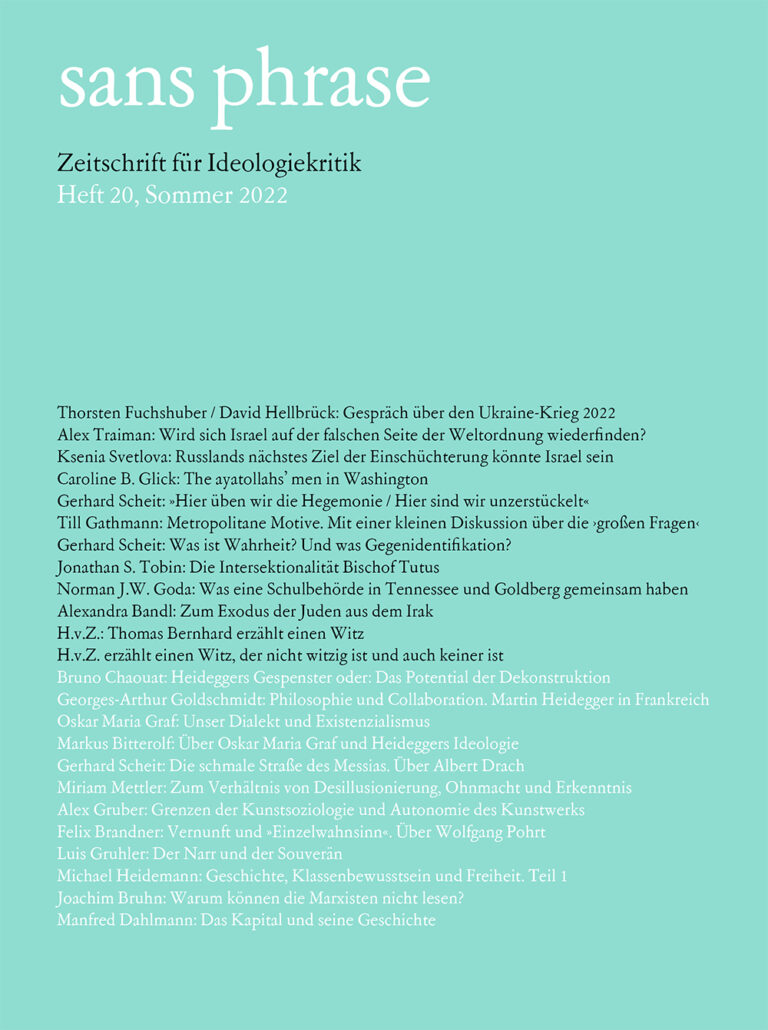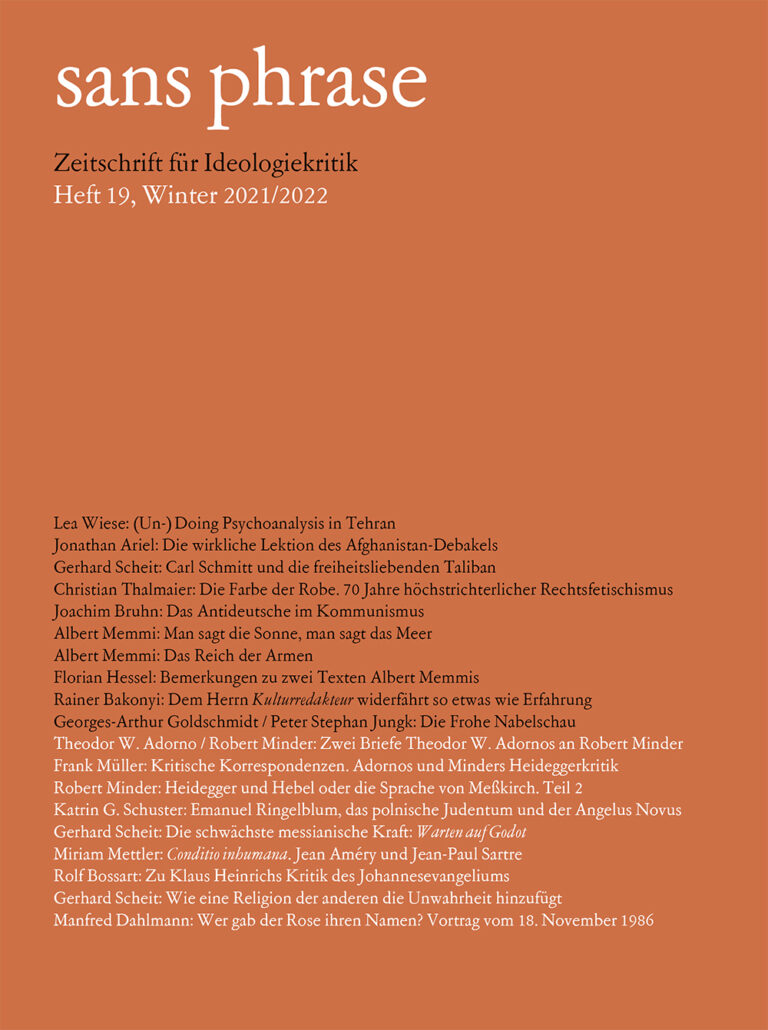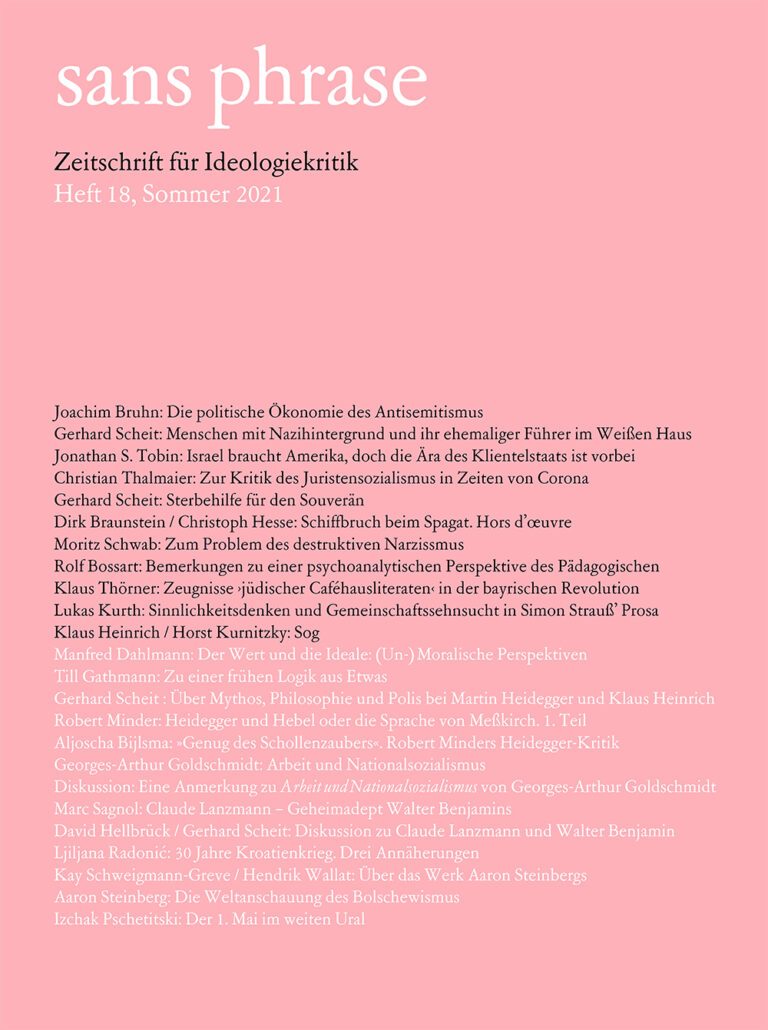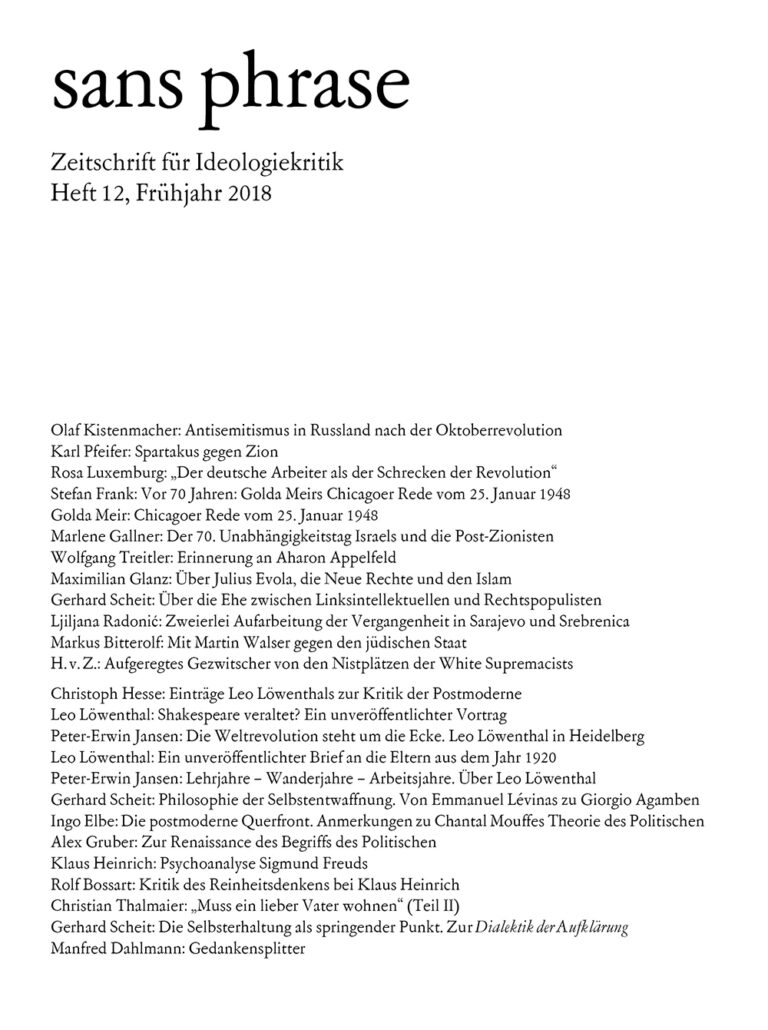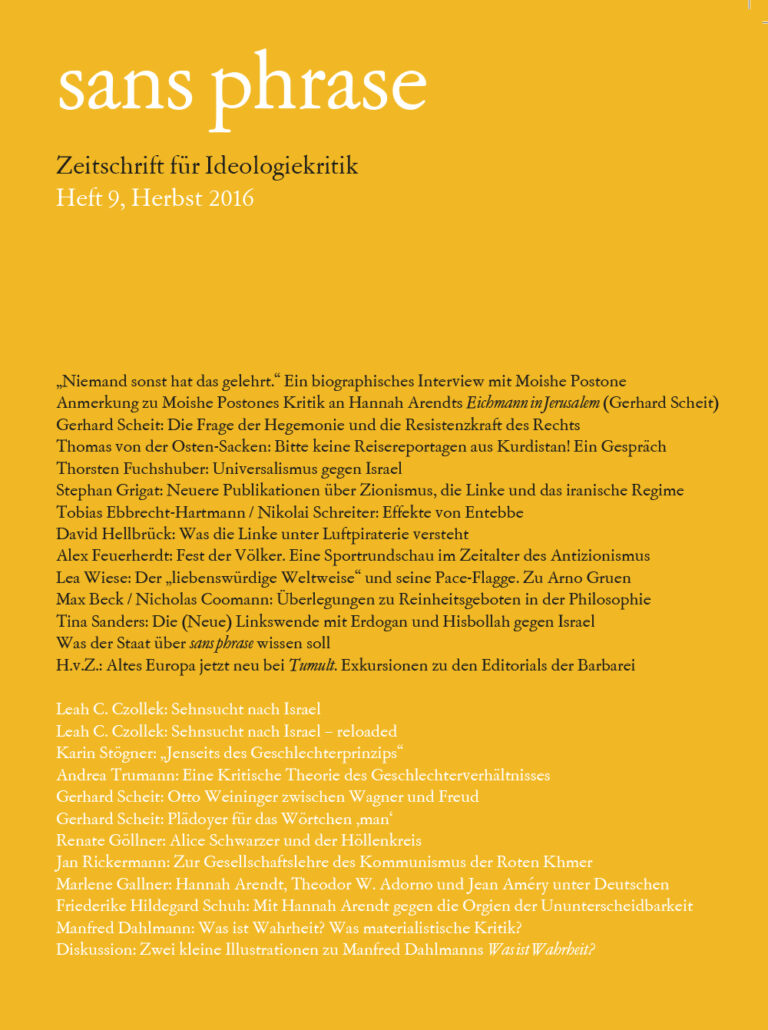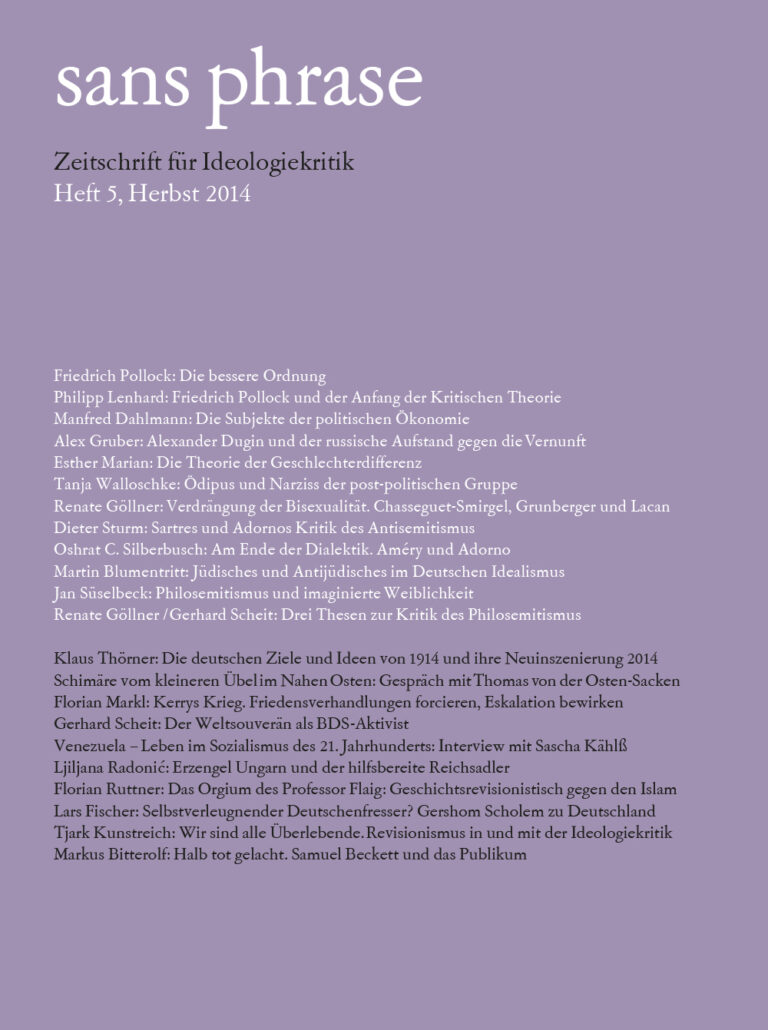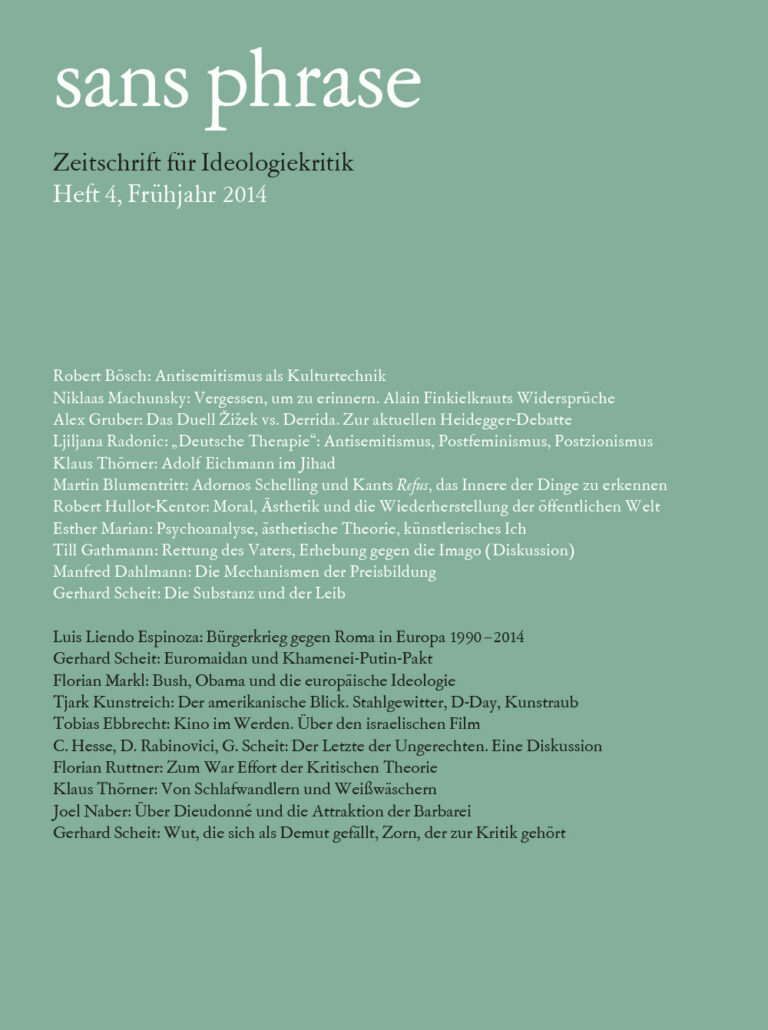Am Ende seiner Besprechung Georg Lukács, der erste marxistische Theologe hält Aaron Steinberg den Konflikt fest, mit dem Lukács im Anschluss an Geschichte und Klassenbewusstsein konfrontiert war: was tun, wenn sich die Beschwörung jenes allgemeinen und durch die Partei angeblich immer schon verkörperten Willens des Proletariats gegen ihren eigenen Theoretiker wendet? Im Ganzen bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder kündigt Lukács die selbstverordnete Logik absoluter Parteilichkeit gegenüber der Partei zugunsten des kritischen Impulses auf oder er wird zwischen Parteistandpunkt und Revision zermalmt. Wie Lukács sich entscheiden sollte, konnte Steinberg zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Überlegungen im Sommer 1924 noch nicht wissen. Nachhaltig beeindruckend an Steinbergs Besprechung ist darum, wie früh er die Bedeutung von Geschichte und Klassenbewusstsein für eine philosophische Grundlegung der Politik Lenins wahrzunehmen vermochte und wie gut es ihm dabei zugleich gelang, die Kritik zu antizipieren, die auch Lukács selbst als Konsequenz seiner eigenen Gedanken entgegenschlagen sollte, nachdem der Leninismus sich als einheitliche Weltanschauung des Bolschewismus konsolidiert hatte. Die Rede der Neuen Linken von der vielbeschworenen Gegentradition des ›westlichen Marxismus‹, als dessen Gründungsdokument Lukács’ Geschichte und Klassenbewusstsein gilt, macht allzu leicht vergessen, dass der Fluchtpunkt von Lukács’ Überlegungen aller philosophischen Häresie zum Trotz immer Moskau geblieben ist: seine philosophische Reformulierung des Marxismus durch die Rückbesinnung auf die Schriften von Marx und des deutschen Idealismus sind auch die theoretische Grundlegung des Leninismus.